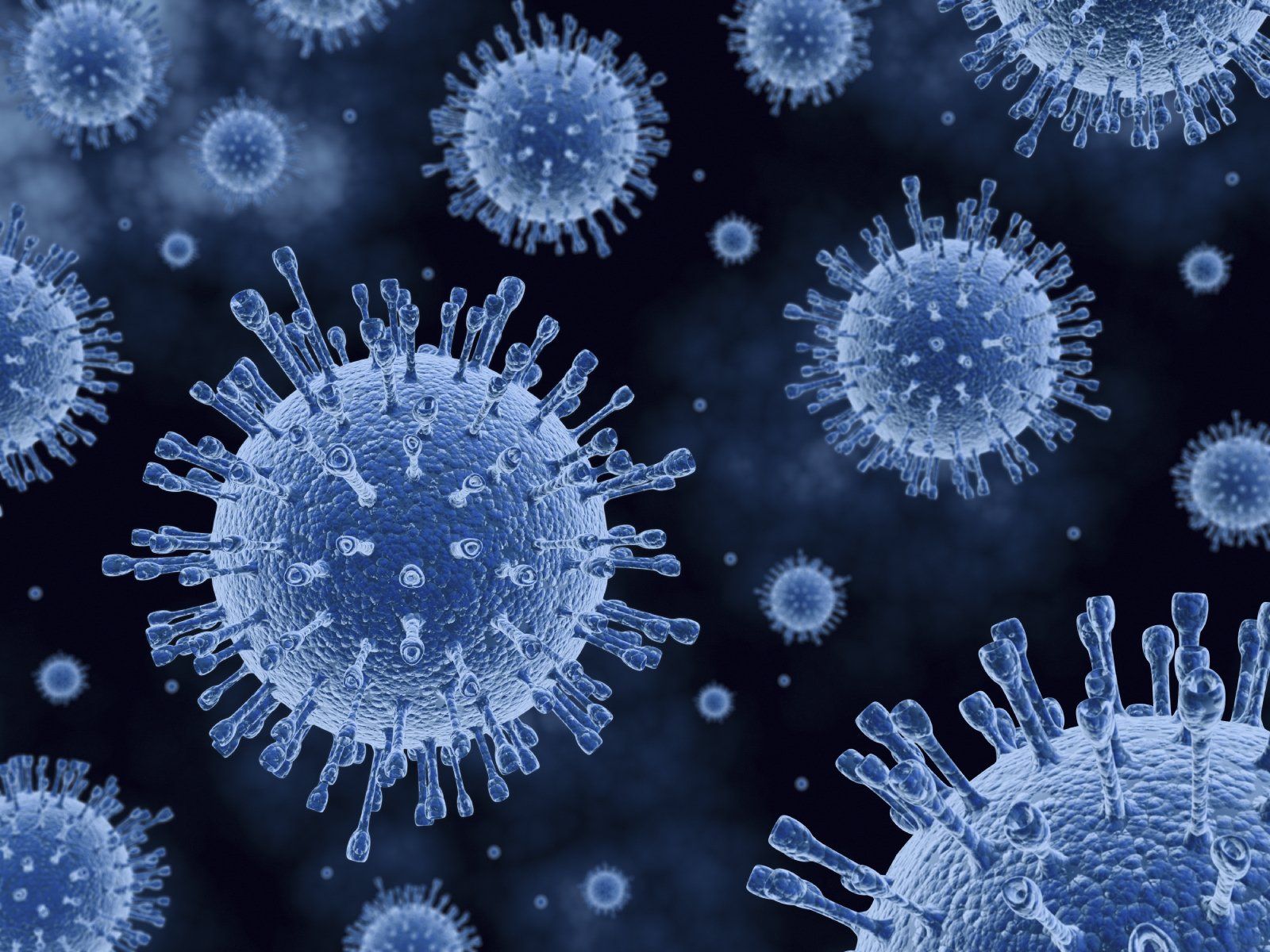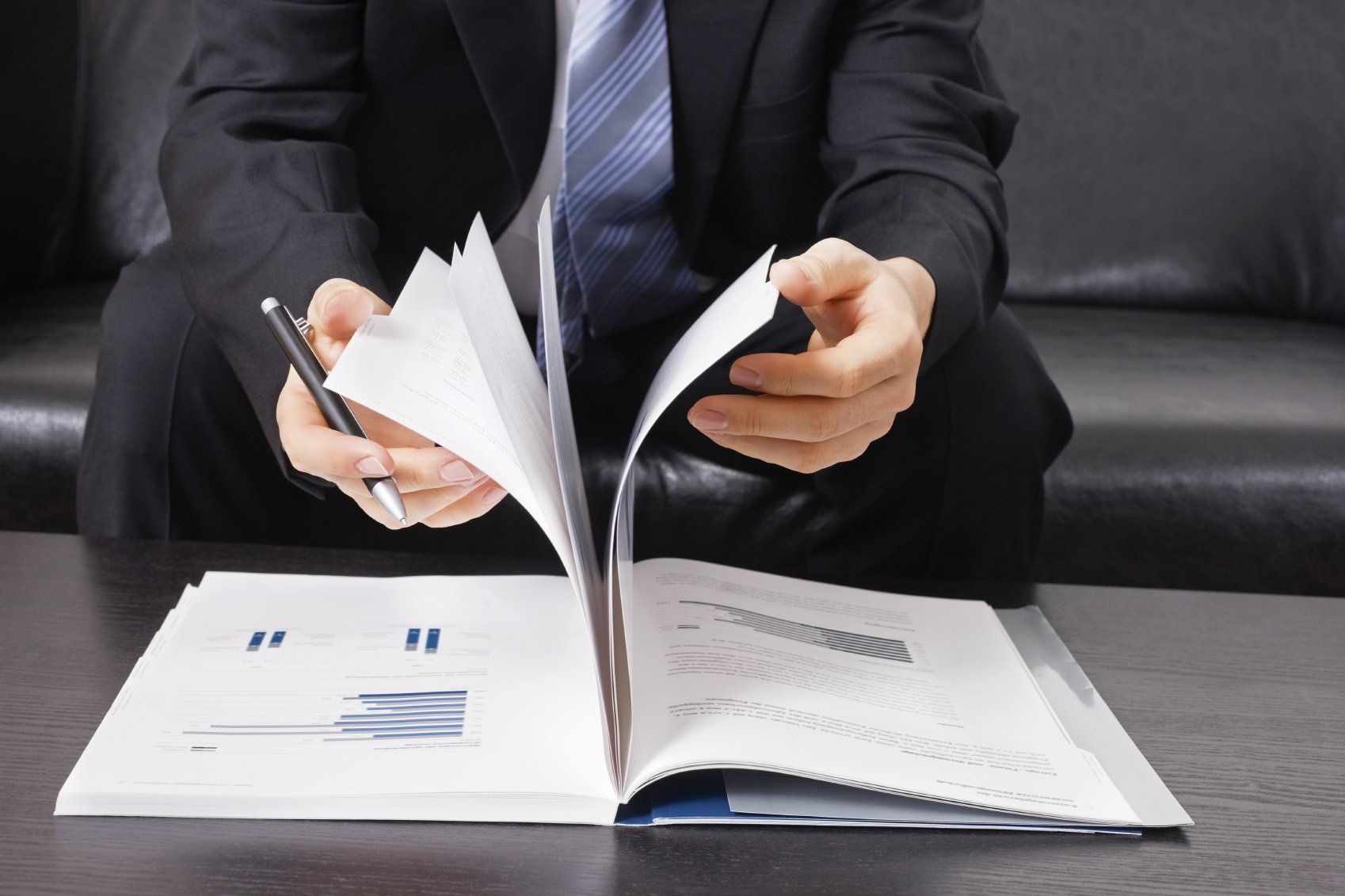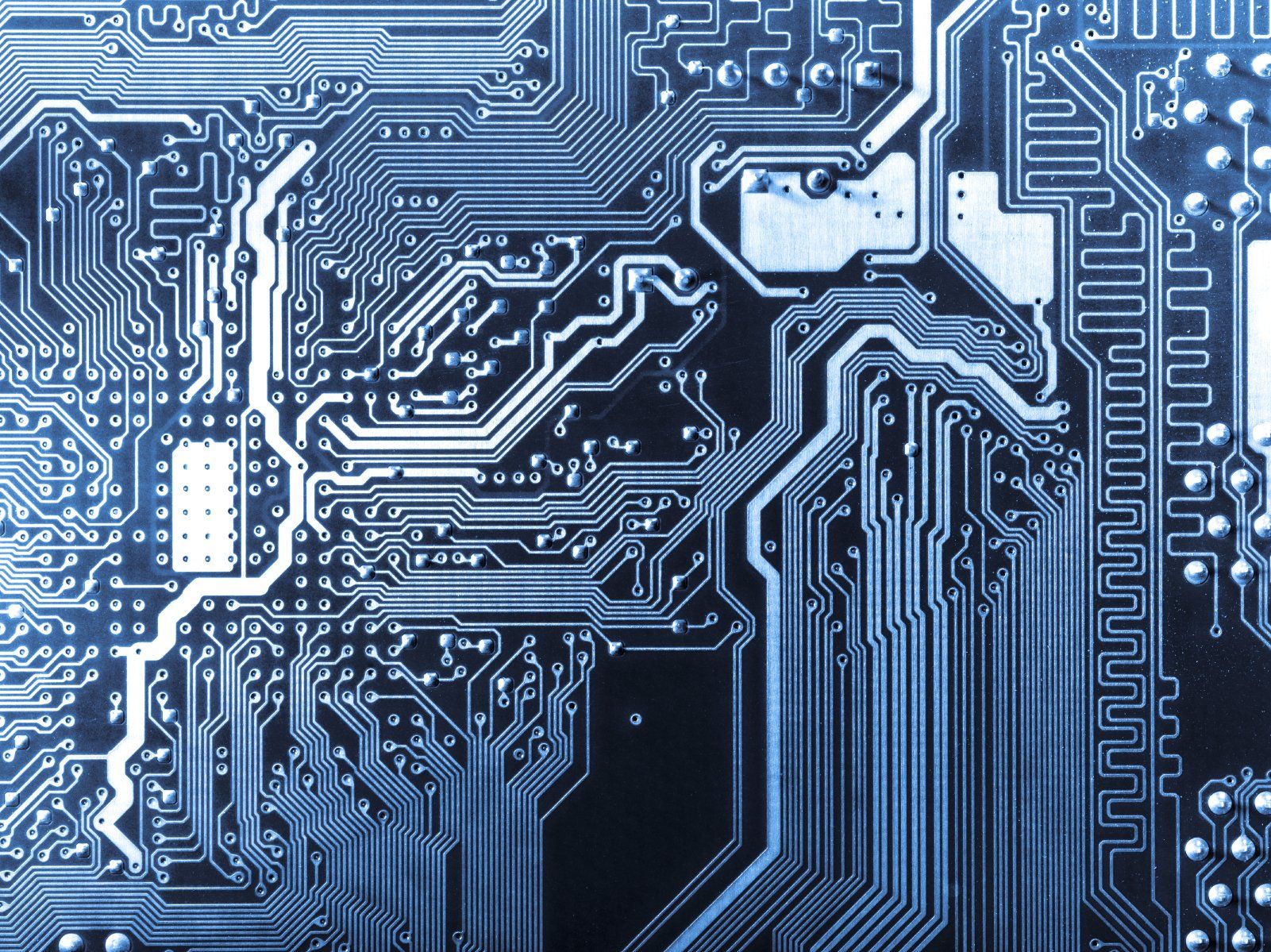Der Risk Blog
Ehrbarer Kaufmann 2.0
Unternehmen sollen profitabel wirtschaften, dabei aber – so verlangt es der Deutsche Corporate Governance Kodex – nicht nur legal, sondern auch moralisch einwandfrei agieren. Was für den Einzelnen schon schwierig genug ist, wird für Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern erst recht zur Herausforderung. Wie der Spagat gelingt.

Der Begriff des Ehrbaren Kaufmanns geht auf das Mittelalter zurück. Damals entstanden Verhaltensnormen, die den Charakter freiwilliger Selbstverpflichtungen hatten und vor allem den Interessen der sich ab dem achten Jahrhundert formierenden Kaufmannsgilden dienten. Neben praktischen Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen gehörten dazu auch soziale Kompetenzen und Tugenden wie Anstand, Verlässlichkeit und Aufrichtigkeit. Zuwiderhandlung hatte gesellschaftliche Ächtung zur Folge – was natürlich auch schlecht war fürs Geschäft.
Der Erfolg eines Kaufmanns hing also auch von seiner Ehre und vom Einhalten bestimmter Normen ab. Moral war kein Selbstzweck, sondern notwendige Voraussetzung sowohl für wirtschaftlichen Erfolg als auch für eine reibungslose Integration in die Gesellschaft der damaligen Zeit.
Interessenkonflikte zwischen Prinzipalen und Agenten
Vergleichbare Regeln für das Handeln wirtschaftlich
Tätiger bildet heute vor allem der Deutsche Corporate Governance Kodex ab. Und noch
immer nimmt der Umgang mit diesen Regeln Einfluss auf den wirtschaftlichen
Erfolg.
Zugleich hat sich aber die (Wirtschafts-)Welt seit dem Mittelalter erheblich
verändert. Vor allem internationale Konzerne werden nur noch selten von ihren
Eigentümern, sondern von angestellten Managern geführt, was die Frage nach
Informations-, Interessen- und Risikoasymmetrien aufwirft (Prinzipal-Agent-Theorie).
Eine Reihe von Governance-Funktionen adressieren mögliche Interessenkollisionen zwischen Prinzipalen und Agenten. So dienen Risiko- und Compliance-Management sowie interne Revision auch dazu, durch Transparenz bestehenden Asymmetrien im Interesse des Unternehmens entgegenzuwirken.
Wie zu viel Reglementierung negativ wirkt
Die aktuellen Corporate Governance-Anforderungen sind in erster Linie Reaktionen auf sichtbar gewordene Defizite in der praktischen Unternehmensführung und -kontrolle. Im Ergebnis sehen sich Unternehmen dadurch mit einer Vielzahl von regulatorischen Anforderungen und gesellschaftlichen Erwartungen sowie gestiegenen Haftungsrisiken konfrontiert.
Gleichzeitig wachsen in Zeiten der Globalisierung Kosten- und Wettbewerbsdruck. Vor diesem Hintergrund stellt sich ständig die Frage, wie regulatorische Anforderungen im Hinblick auf Risikomanagement und Compliance erfüllt werden können, ohne dadurch an Effizienz, Agilität und Geschwindigkeit zu verlieren.
Um diesen Spagat zu bewältigen, haben viele Unternehmen
ihre Governance-Strukturen massiv gestärkt und in den Aufbau von
(kontrollbasierten) Überwachungsmechanismen investiert, eine Entwicklung, die
bei allen positiven Effekten auch zwei gravierende Nachteile hat: Erstens sind
Governance-Systeme, die allein auf Kontrollen und Prozessen basieren,
ressourcenintensiv und teuer, außerdem tendieren sie dazu, Agilität und Innovationskraft
negativ zu beeinflussen.
Zweitens macht zu starke interne Reglementierung ein Unternehmen gerade für
jene unattraktiv, um die im „War for Talents“ alle kämpfen: Junge,
leistungsbereite Mitarbeiter, für die individuelle Freiräume essentiell sind.
Compliance-Verstößen in der Realwirtschaft mit rein kontrollbasierten Governance-Systemen begegnen zu wollen, ist also kein sinnvoller Ansatz, weil er zu viele Nachteile mit sich bringt.
Warum kulturbasierte Ansätze helfen
An diesem Punkt der Diskussion taucht immer häufiger der Begriff „Integrität“ auf, vom Duden übersetzt als „Makellosigkeit, Unbescholtenheit, Unbestechlichkeit“. Ursprünglich leitet sich das Wort aus dem lateinischen „Integritas“ ab und bedeutet so viel wie Einheit oder Ganzheit. Kurzum: Bei Integrität geht es um das übereinstimmende, konsistente Verhalten einer Person mit den von ihr gesetzten Werten, aber auch um das Eingebettetsein in die Wertevorstellungen der Umwelt.
Auf Basis dieses Begriffsverständnisses hat sich
der Autor dieses Beitrags in Zusammenarbeit mit Vertretern aus Wissenschaft und
Praxis im „Forum Compliance & Integrity“ des Deutschen Netzwerks
Wirtschaftsethik strukturiert mit der Frage beschäftigt, was Integrity im
Unternehmenskontext bedeutet.
Demnach liegt Integrity dann vor, wenn sich ein Unternehmen bewusst zu
moralischem Handeln bekennt, sich eigene Werte und Prinzipien setzt, die der
eigenen Unternehmensidentität entsprechen, und wenn es schließlich konsistent
nach diesen Werten und Prinzipien handelt. Oder anders ausgedrückt: Integrity
Management bezeichnet die Fähigkeit einer Organisation und besonders ihrer
Führungskräfte, die Unternehmenswerte durch Führungsstil und Vorbild in der
alltäglichen Praxis der Geschäfts- und der Unternehmenskultur mit Leben zu
füllen.
Der Nutzen für Risiko- und Compliance Management
Integrity Management ist damit integrativer Teil
der Corporate Governance und geht über Legal Compliance hinaus.
Sein konkreter Nutzen lässt sich am besten an zwei Teilgebieten der Corporate
Governance aufzeigen, nämlich dem Risiko- und dem Compliance-Management.
- In beiden Fällen geht es darum, die notwendigerweise allgemein gehaltenen risikopolitischen beziehungsweise compliancebezogenen Grundsätze im konkreten unternehmerischen Alltag mit Leben zu füllen.
- In beiden Fällen obliegt es dem Unternehmen, gesetzliche Anforderungen so in das Unternehmen zu übertragen, dass sie zuverlässig eingehalten werden.
- Und in beiden Fällen gilt es, Mitarbeitern Orientierung im Umgang mit (Compliance-) Risiken zu vermitteln, ohne sie in ihrer Kreativität und Wertschöpfungsorientierung unnötig einzuschränken.
Werte des Unternehmens dürfen dabei nicht als beschränkende, sondern sie sollten als ermöglichende Bedingung aufgefasst werden. Denn schließlich sind Risiko- und Compliance-Management keine Instrumente, um Risiken komplett zu vermeiden, sondern um Risiken auf verantwortliche Weise einzugehen und gerade auch dadurch Wertschöpfungspotenziale zu realisieren.
Wo Integrity Management ansetzen kann
Die aktuelle Debatte rund um Maßnahmen zur Förderung einer Kultur der Integrität benennt vor allem zwei Anknüpfungspunkte: den Code of Conduct (häufig auch Integrity Code oder Verhaltensrichtlinie genannt) und Mitarbeiterschulungen. Dabei fällt auf, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen meist einen eher geringen Bezug zur täglichen unternehmerischen Praxis aufweisen. So wichtig eine Verhaltensrichtlinie als Orientierungsrahmen ist, so wenig hinreichend ist diese, wenn es darum geht, das Verhalten von Mitarbeitern im Alltag tatsächlich zu steuern. Ebenso können Schulungen dabei helfen, Mitarbeiter auf allen Ebenen für Fragen der Integrität zu sensibilisieren oder im Umgang mit Dilemmata zu befähigen. Weichen die Anreize in den täglich erlebten Prozessen jedoch von den in Schulungen genannten Idealen ab, droht die Gefahr, dass Integrität zu einem Orchideenthema degeneriert, das zwar in Sonntagsreden eingefordert, aber in der Praxis nicht mit Leben erfüllt wird.
Konsequentes Integrity Management erfordert daher eine durchgängige Identifikation, Analyse und Bewertung sowie Anpassung sämtlicher verhaltensrelevanter Steuerungsmechanismen im Unternehmen – vom Einkauf über den Leistungserstellungsprozess bis zum Vertrieb. Hierbei dürfen Wertschöpfungsinteressen und Stakeholder-Anforderungen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Vielmehr sollten – dem Shared Value-Ansatz folgend – Aktivitäten gefördert werden, die sowohl den ökonomischen Interessen als auch den durch das Unternehmen definierten Werten entsprechen.
Drei Beispiele sollen dies verdeutlichen:
- Unternehmen, die ein hohes Maß an Verantwortung für die Region, in der sie ansässig sind, proklamieren, sollten (wo immer sinnvoll und möglich) Produkte bei lokalen Anbietern beschaffen. Damit stärken sie einerseits die regionale Wirtschaft und sichern lokale Arbeitsplätze; andererseits vereinfachen sie die Logistik und sparen Transportkosten.
- Unternehmen, die sich auf die Fahnen schreiben, ihren Mitarbeitern gegenüber besonders fürsorglich zu agieren, sollten beispielsweise ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen, das von altersgerechten Arbeitsplätzen über Nichtraucherkampagnen bis hin zum Obstkorb reichen könnte. Damit leisten sie ihren Beitrag zum Wohlbefinden ihrer wichtigsten Ressource; gleichzeitig lassen sich so Fehlzeiten reduzieren und Krankheitskosten senken.
- Unternehmen, denen eine gut ausgebildete Mitarbeiterschaft wichtig ist, sollten sich über betriebliche Weiterbildungen hinaus in der (lokalen) Bildungslandschaft engagieren. Sie stärken damit die Region als Lebens- und Wirtschaftsstandort. Andererseits sichern sie sich frühzeitig gut ausgebildete Mitarbeiter und erhöhen über berufsbegleitende Angebote die Loyalität der Mitarbeiter zu ihrem Unternehmen.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Bei Integrity Management nach dem Shared Value-Ansatz geht es nicht um die Neuverteilung geschaffener Vermögenswerte, sondern darum, die Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens so zu gestalten, dass wirtschaftliche Interessen und die von einem Unternehmen definierten (moralischen) Werte in Einklang gebracht werden. Die Beispiele verdeutlichen, dass dies nicht immer aufwandslos möglich ist, sondern echte Dilemmata entstehen können, deren Lösung Anstrengungen erfordert. Die Beispiele zeigen aber auch, dass es Schnittmengen zwischen den (berechtigten) moralischen Ansprüchen diverser Stakeholder und den (ebenso berechtigten) Wertschöpfungszielen des Unternehmens gibt. Diese Schnittmengen zu ergründen und beiden Interessenspektren zugänglich zu machen: auch das ist Integrity Management.
Schließlich hängt die Glaubwürdigkeit der Integritätskultur eines Unternehmens wesentlich davon ab, ob es diesem gelingt, Integrität nicht nur gegenüber seinen Mitarbeitern einzufordern, sondern diese auch mittels gesellschaftlichem Engagement zu demonstrieren und (moralische) Werte zu proklamieren. Eine konsistente, die gesamte Wertschöpfungskette betreffende Ausrichtung des Unternehmens an diesen autonom definierten Werten ist die Grundlage für ein nachhaltiges, Wirtschaft und Moral verzahnendes Management – ganz im Sinne der Prinzipien des Ehrbaren Kaufmanns.
Dieser Beitrag erschien im CGO Magazin. Mehr Informationen zum KPMG CGO Magazin finden Sie hier.